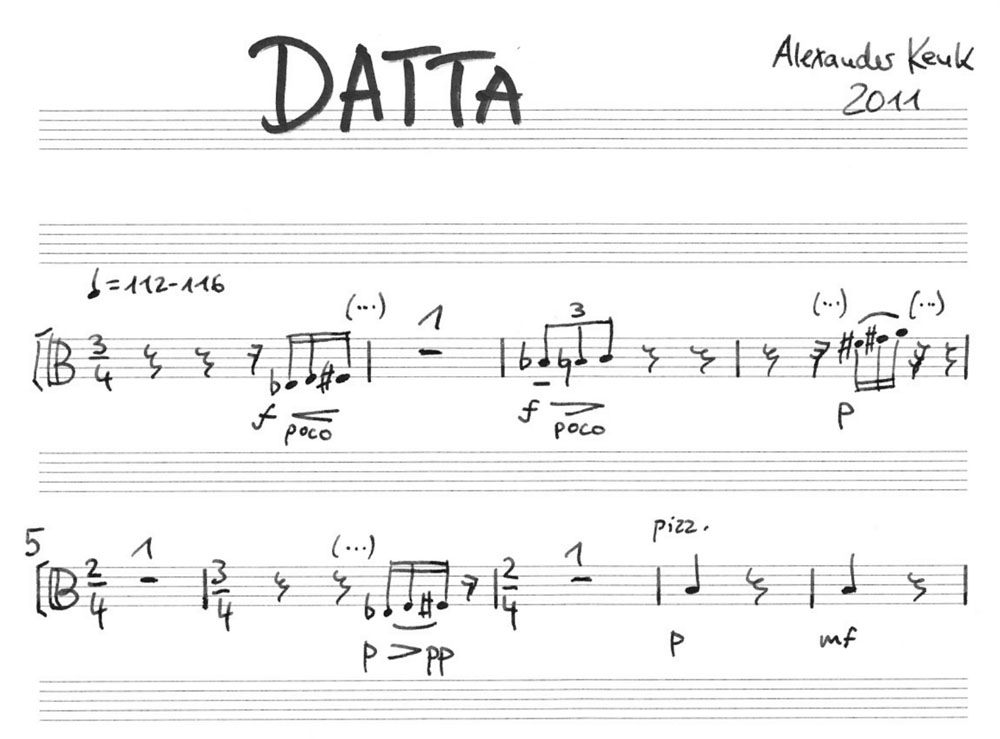Am Sonntag findet bereits die letzte Dresdner Aufführung von Weinbergs »Passagierin« statt. Ich habe die Oper gestern das erste Mal gesehen und bin mit gemischten Gefühlen gegangen. KZ-Aufseherinnen, die mit Schlagstöcken Lufthiebe austeilen, und eine KZ-Insassin, die mit opernhaftem Schmelz und reichlich Vibrato ein russisches Volkslied singt, während die anderen Insassinnen, in mollige Decken gehüllt, im Kreis um sie versammelt sitzen? Da musste ich an einen Text aus meinem Studium denken, den ich hier in Ansätzen wiedergeben möchte, für Ulli, Stefan, Oleg, Adina und alle, die Lust haben, sich vielleicht vor diesem Hintergrund noch einmal über die Inszenierung zu unterhalten.
Grenzen des Realismus
(aus dem Seminar »Ästhetische Kontroversen des 20. Jahrhunderts« bei Prof. Dr. Albrecht v. Massow, Juli 2000)
Aus wie viel Verstummen gebiert sich Veränderung ?
Wer ist noch so fühlend, das Nichtgesagte zu erahnen ?
Thomas Buchholz, Komponist
Kammersinfonie IV »Todesfuge«
Mit einem Werk umzugehen, das den Holocaust thematisiert, ist nicht einfach. Einerseits stellten sich nicht nur Künstler oft die Frage, ob ein geschichtliches Ereignis dieser Dimension überhaupt in einer angemessenen Weise künstlerisch verarbeitet werden kann – und soll. Andererseits stellt sich die Frage nach der Bewertung solcher Kunst. Können, dürfen wir diese Kunst überhaupt kritisieren, und wenn, welche Maßstäbe gelten für die Werke?
Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob Kunst aus solchem Inhalt Ausdruck gewinnen darf, ob es sich überhaupt gebührt, eine Art von Kunstgenuß zu fordern und zu geben, wo andere Menschen ‚unsagbar‘ – unsingbar? – gelitten haben, zu Tode kamen.
„Je totaler die Gesellschaft, um so verdinglichter auch der Geist und um so paradoxer sein Beginnen, der Verdinglichung aus eigenem sich zu entwinden. Noch das äußerste Bewußtsein vom Verhängnis droht zum Geschwätz zu entarten. Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber: nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es möglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Der absoluten Verdinglichung, die den Fortschritt des Geistes als eines ihrer Elemente voraussetzte und die ihn heute gänzlich aufzusaugen sich anschickt, ist der kritische Geist nicht gewachsen, solange er bei sich bleibt in selbstgenügsamer Kontemplation.“(2)
Adornos Behauptung, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben, sei barbarisch, hatte (sicherlich auch wegen der Radikalität der These) schnell Bekanntheit erlangt und wurde von vielen Dichtern als Verdikt interpretiert.(3) Besonders betroffen mußte sich Paul Celan fühlen; für ihn hatte die Laufbahn des Dichters eben erst wieder begonnen, aus den Motiven, die schreckliche Vergangenheit zu verarbeiten und wieder zu einer Art von sinnvollem Leben zu finden. Celan schrieb in der Sprache der Mörder seiner Eltern und Freunde; nur so sah er sich in einer Lage, den Ermordeten zu gedenken. Viele Briefe, Gedichte und Erzählungen später (unter anderem „Gespräch im Gebirg“, eine Erzählung über „die deutsche Sprache, die einem Juden nach Auschwitz bleibt, der in der Sprache der Mörder, mit all ihren Abgründen und Tiefen, Untergängen und Verwerfungen, Gedichte schreiben und sprechen muss“) und einem sehr deutlichen Vorwort zu dem Band Atemwende (suhrkamp 1967: „Kein Gedicht nach Auschwitz (Adorno): was wird hier als Vorstellung von ‚Gedicht‘ unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht hypothetisch – spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigallen- oder Singdrossel-Perspektive zu betrachten oder zu berichten„.) sah sich Adorno zum Einlenken, Korrigieren bereit:
„Das perennierende [lang andauernde] Leiden hat soviel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu brüllen; darum mag falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe sich kein Gedicht mehr schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse.„(4)
Diese Frage hat Paul Celan für sich 1970 beantwortet: sein Freitod in der Seine schien ihm einziger Ausweg zu sein. Indes war sein Wirken von eminenter Wichtigkeit für ein neues (Selbst-)verständnis der deutschen Literatur nach 1945:
„So wollen wir auch [Peter] Szondi zustimmen, wenn er mit dem Blick auf Celan Adornos Satz abändert: Nach Auschwitz ist kein Gedicht mehr möglich, es sei denn auf Grund von Auschwitz. Wir können seitdem vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass heute in Deutschland wieder unbefangene Gedichte möglich sind, weil Celan mit seinem poetischen Werk unserer Befangenheit eine Sprache gegeben hat, die brüderlich vernommen und nachgesprochen werden kann. Wir sehen darin, jenseits aller vordergründigen Ästhetik, nicht nur eine moralistische und politische Haltung. sondern den Ausdruck einer fast messianischen Stellvertretung, die nach der Katharsis dieser Gedichte, wenn man sie beklommen gelesen hat, vielleicht Unbefangenheit wieder möglich macht auf Grund von Celan.“ (Harald Weinrich, Die ZEIT vom 23.07.1976, S. 38)
Über fünfzig Jahre nach dem Ende des Krieges sehen wir uns nach wie vor der Frage gegenüber, wie wir mit Kunst, die das Grauen verifiziert, umgehen sollen; die Frage indessen, ob solche Kunst Berechtigung habe, können und müssen wir unbedingt bejahen. „Man kann nach Auschwitz nicht mehr so schreiben, als hätte es Auschwitz nicht gegeben“ (Rolf Hochhuth) – das mag stimmen; aber das Schreiben deswegen hinfort aufzugeben, wäre sicherlich der falsche Weg. Obwohl Haimo L. Handl klarstellt: „Ihm [Adorno] ging es nicht um Verschweigen als Vergessen, sondern um eine Entsprechung, eine Würde, eine Humanität, die sich nicht des Wissens und der Erinnerung des Barbarischen verschließt und aus diesem Verständnis keine Gedichte schreibt, keine Kultur wie bis anhin übt, weil dies Verrat wäre, weil es unwürdig wäre.“(5) – das Schweigen ist keine Lösung, denn: „Wer ist noch so feinfühlig, das Nichtgesagte zu erahnen?“ (Thomas Buchholz, s.o.). Ein Schweigen käme demnach dem Vergessen gleich, gleichgültig, ob es aus Rücksicht oder aus Verweigerung sich definiert. Und die Mahnung – sie ist nach wie vor angebracht.
Das Schlimmste, was Kunstwerken zustoßen kann, ist die verflachende Kritik, oft nach Rezeption ohne jegliches Wissen um die Umstände. Als ich „Different Trains“(1) Anfang der neunziger Jahre auf dem Dresdner Hauptbahnhof „auf Tournee“ in einer Aufführung mit dem Kronos Quartett erlebte, war der Inhalt des Werkes unbemerkt der Ausschlachtung eines Events gewichen. Das Argument, die Bewertung von Kunst dürfe nicht vom Hintergrundwissen des Zuhörers abhängen, kann hier nicht gelten: niemand kann Ereignisse wie den Holocaust so künstlerisch umsetzen, so daß ihr Äußeres den wahren Inhalt enthüllen würde. So bekennt Dieter Lamping, „daß dem literarischem Realismus in der Holocaust-Lyrik Grenzen gesetzt sind“. (6)
Steve Reich hat mit „Different Trains“ eine Variante der Aufarbeitung gewählt, die ein Kritiker als eher banal, vereinfacht oder forsch-naiv bezeichnen könnte; in Deutschland wäre man mit dem Thema vermutlich anders, viel vorsichtiger, zurückhaltender, tiefgreifender umgegangen. Wenn wir jedoch deswegen auf eine Aufarbeitung verzichteten; weil uns die Form nicht angemessen erscheint, weil es unter Umständen nie eine angemessene Form geben kann, dann haben wir den ersten Schritt zur Verschleierung und Verdummung getan.
Quellen:
(1) Reich, Steve. Different Trains (CD). Elektra/Nonsuch 1989 (7559-79176-2)
(2) Adorno, T.W. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. München 1963, S. 26.
(3) Seng, Joachim. „Ab- und Wiesengründe: Celan, Adorno und ein versäumtes Gespräch im Gebirg.“ Frankfurter Rundschau (25.11.2000).
(4) Adorno, T.W. „Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit.“ Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden (Band 6). Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970-86. 355
(5) Handl, Haimo L. „Theodor W. Adorno – Gedanken zum Gedenken.“ Volksstimme 35 (1994).
(6) Lamping, Dieter. „Gedichte nach Auschwitz, über Auschwitz.“ Poesie der Apokalypse. Hg. Gerhard R. Kaiser Würzburg (1991). 237-255.
Beitragsbild: Konfuziusmuseum, Beijing, Nov. 2017